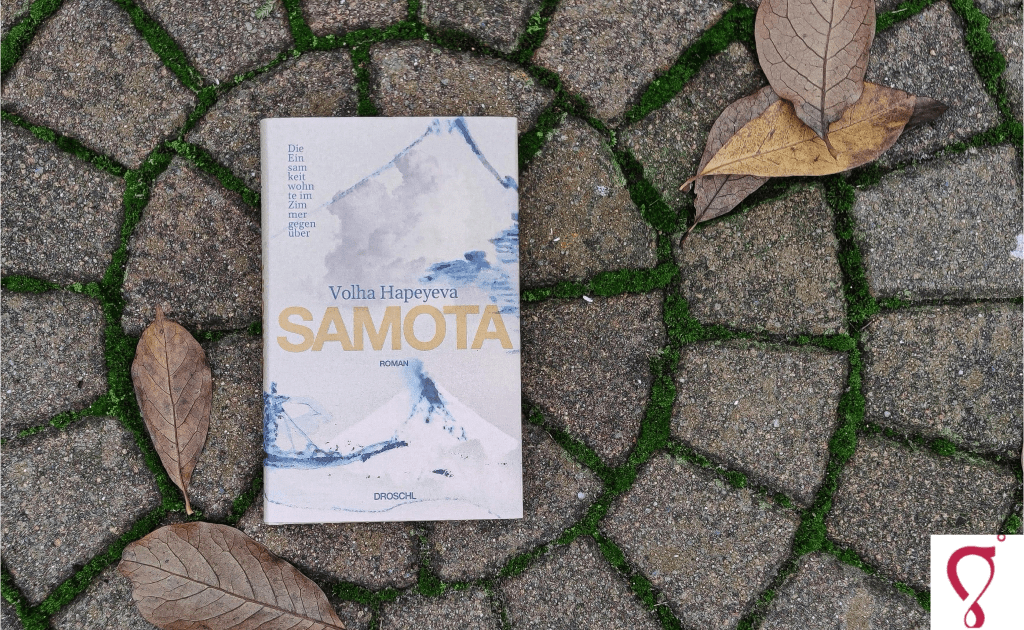
von Nele Miesner
Ist Gewalt an Tieren vertretbarer als an Menschen? Wieso sind uns Haustiere mehr wert als Wildtiere? Und warum wird das Töten umso einfacher, je kleiner die Lebewesen sind?
Volha Hapeyevas Roman Samota begibt sich auf die Reise nach Antworten auf diese Fragen. Von Beginn an finden sich die Leser:innen in einer ausgezehrten, trostlosen Welt wieder, aber da sind Figuren, die leuchten und kämpfen und sich aufopfern. Maya, Vulkanologin, besucht einen Kongress zur „Regulierung von Tierpopulationen“. Die vermeintlich kühle, aber hypersensible Protagonistin muss sich in einer Welt zurechtfinden, der in ihrer globalen Vernetzung jegliche Beziehungshaftigkeit abhanden gekommen ist. Mit Hapeyevas Worten könnte man behaupten, Maya „ist die erste Pflanze, die nach Vulkanausbrüchen wieder auf den Lavaströmen wächst“ (S. 184).
Samota mutet novellenhaft an, da neben Mayas Realität noch eine weitere Ebene eröffnet wird. Sebastian, ein scheinbar aus der Zeit gefallener junger Mann, trifft auf den Wolfsjäger Mészáros (dt. Metzger). Zugleich deckt er die Lebensgeschichte seines Vermieters auf, der einmal Henker war. Zwischen diesen Ebenen wandelt Helga-Maria beinahe geisterhaft hin und her, sie ist Maya eine Freundin und Beraterin und zugleich Adressatin von Sebastians Liebesbriefen. Die narrativen Grenzen verschwimmen zwischen Traum und Realität, umso deutlicher wird das Plädoyer für mehr Miteinander: Immer wieder tauchen neben der übersichtlichen Figurenkonstellation andere Lebewesen auf, deren Erfahrungen von Gewalt geprägt sind, wie das Ernten von Seidenraupen, kollektivem Kuhsuizid oder der Begasung von Hasenbauten. Dem gegenüber stehen jedoch feine Beobachtungen wie diese:
„Nach einer Woche kehrte ich wieder zu mir zurück. […] Als ich zur Zimmerdecke blickte, sah ich ein ephemeres Fädchen, das nirgendwo begann und nirgendwo endete. […] Für mich war es ein Zeichen für Leben. Jemand war bei mir. Wenn auch auf acht hauchdünnen Beinen.” (S. 86)
Samota steht für Empathie über Humanität hinaus. Ein zentrales Symbol ist dabei der Hund: Helga-Maria wird als Tiertherapeutin von einem begleitet, Maya versucht, traumatische Schuldgefühle wegen dem Hund ihrer Kindheit aufzuarbeiten, und zwischen Sebastian und Mészáros kommt es zur Konfrontation um ein Wolfsjunges. In harawayscher Manier könnte man behaupten, in der menschlichen Beziehung zum Hund spiegele sich der Zustand der Welt.
In magisch-realistischem Gestus wirft der Roman auch immer wieder Fragen nach Erinnerungen und Zeit auf: Sind wir unserer Vergangenheit schutzlos ausgeliefert oder kann unsere Zukunft auch anders aussehen, als unsere Vergangenheit es prophezeit? Können wir der Einsamkeit, die im Zimmer gegenüber wohnt, wie es im Untertitel heißt, noch entkommen? Für Hapeyeva führen diese Fragen unweigerlich in die Sprache, mit der wir uns und die Welt um uns herum normieren. Auf verspielte Art und Weise entlarvt der Roman unseren sprachlichen Anthropozentrismus, wir hierarchisieren, ent- und vermenschlichen. Kurz, Samota ist vor allem ein Denkanstoß, zugewandter zu sein, trotz dieser Welt.
Samota: Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber, Volha Hapeyeva, übersetzt aus dem Belarusischen von Tina Wünschmann und Matthias Göritz, Literaturverlag Droschl, 189 Seiten, Hardcover, 25€.
