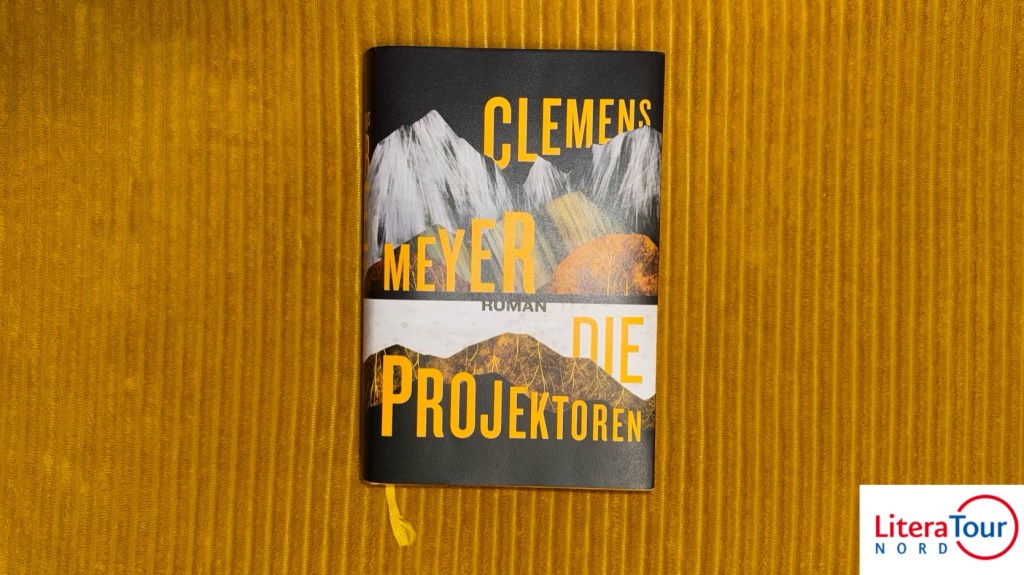
von Anna Tangemann
Autor des Romans des Jahres zu sein, ist sicher kein Attribut, das man sich selbst zuschreibt. Und doch hat Clemens Meyer mit dem Statement, nicht Martina Hefter, sondern niemand Geringeres als er selbst hätte den Deutschen Buchpreis gewinnen sollen, unlängst für Furore gesorgt. Mit Die Projektoren legt er ein Epos vor, das an Empathie auf über 1000 Seiten wieder wettmacht, was Meyers realweltliche Äußerungen missen lassen. Es geht ums Kino, dessen Vorführstätten im Roman Bioskop zu heißen pflegen, den Krieg, die Liebe, den Tod und ums Große und Ganze. Und genauer? Das ist schwer zu fassen, so komplex ist die Narration, die häufig die Perspektive wechselt und mit Zeitsprüngen gespickt ist. Nicht jeder Handlungsstrang ist in sich auflösbar. Den verschiedenen Wendungen, die der Roman nimmt, ist jedoch eins gemein: Alle Wege führen in den Balkan und die meisten in den Krieg.
Clemens Meyer, Jahrgang 1977, hat in Leipzig Literatur studiert und verdingt sich auch journalistisch und als Literaturübersetzer. Er hat der Schriftstellerei einiges geopfert, allem voran materiellen Wohlstand. Die Projektoren, ein Werk, an dem er sieben Jahre lang gearbeitet hat, ist nicht sein erster Roman. Schon mit Als wir träumten, seinem Debüt 2006, konnte er sich einen Namen machen – und dieser soll jetzt eine neue, epische Dimension erhalten.
Die Projektoren entwickelt eine verschachtelte Handlung. Die wichtigsten Schauplätze: die Irren-Hilfs-Heil- und Pflegeanstalt des Dr. Güntz, eine Leipziger Psychiatrie, deren dottores mit fragwürdigen Methoden und geringem Erfolg ihre Patienten zu heilen versuchen, die DDR und BRD im Licht erst jugendlicher, dann erschreckend professionalisierter Neonazis und sogenannter Gastarbeiter, Jugoslawien und seine Nachfolger und dabei ganz besonders das Velebit-Gebirge. Sein wichtigster Bewohner: eine Figur, die von allen nur Cowboy genannt wird und deren Verbindung zu vielen weiteren Perspektiv- und Handlungsträgern nach und nach offengelegt wird. „Das große Wesen, euer sagenhafter Velebit“, sagt der Cowboy und man spürt die Magie, die dieser so kriegsbeständige Ort ausstrahlt. Der erzählerische Rahmen: Karl May, seines Zeichens ebenfalls dottore und Vorbote eines nicht eintretenden Friedens. Was verwirrend klingt, erfordert einen Fokus beim Lesen, bei dem man sich Notizen zu machen versucht ist, um auch ja am Ende die vielen Handlungsstränge zu einem schlüssigen Sinn zusammenführen zu können. Der Leser, das weiß man bereits nach wenigen Seiten, soll mitarbeiten beim Verständnis dieses Buches; es macht Angebote, aber annehmen muss man sie schon selbst.
Mitunter scheinen Ausgestaltungen und Begegnungen von Figuren schier grotesk. Der Fragmentarist zum Beispiel, eine Figur, die unter verschiedenen Namen firmiert und als Konstante doch ständig neu konstituiert wird, gibt der Welt zwischen den Buchdeckeln und außerhalb davon Rätsel auf – nicht alles bleibt nachvollziehbar in diesem Werk, aber nicht ein Wort darin wirkt willkürlich.
Man möchte weinen angesichts der Schönheit von Meyers Sprache und der Grausamkeiten, die er schildert. An Gewalt wird nicht gespart, eine Unzahl an Kriegen hat im 20. Jahrhundert in Südosteuropa gewütet und das ist deutlich zu erkennen an den Figurenporträts, die Meyer zeichnet. Der Cowboy, der schon als Jugendlicher Botengänger für die Partisanenarmee war, die Insassen der Leipziger Anstalt, viele davon kriegstraumatisiert, die faschistische Gruppe, die freiwillig in den Krieg reist, sie alle sind untrennbar mit Bildern von Gewalt verbunden. In den zumeist langen, aber alles andere als langatmigen Kapiteln reist man mit Karl Mays Geschichten durch persönliche Tragödien und gesellschaftliche Traumata, auf die Gipfel des Tulove grede, in den Wilden Westen, in die USA und in den Nahen Osten. Was die Handlung an Stringenz sicher bieten könnte, was Meyer an Stringenz aber nicht zu bieten bereit zu sein scheint, gleicht seine Narration aus, stets auf Details bedacht, sorgfältig abgewogen und geradezu cinematisch ausgearbeitet.
Die fernen Welten und Zeiten fühlen sich zum Greifen nah an, wenn man mit dem Cowboy und Konsorten durch Jugoslawien, Serbien, Kroatien, das geteilte und vereinte Deutschland und viele andere Schauplätze reist. Grenzen, das jedenfalls ist eine klar benennbare Botschaft des Romans, „wurden verlegt, verglast, zersetzt, ersetzt, verloren, gewonnen, erbaut und abgerissen, königlich und kaiserlich, sozialistisch, faschistisch“ und vieles mehr. Gelitten haben darunter überall stets jene, die Meyer in erster Linie als Menschen und dann erst als Kämpfer porträtiert. Dabei rutscht er nicht mal einen Halbsatz lang ins Dramatische ab. Ruhig, unaufgeregt, aber in allen Tönen, die die Geschichte erfordert, erzählt er von Ländern, die es nicht mehr gibt, und vielem, was dazu geführt hat.
Ein wenig ist es, als würden die Projektoren, die Stumm- und Abenteuerfilme, Karl May höchstselbst und längst verlebte Momente auf Leinwände bannen, auch diesen Roman projizieren: Tausende Strahlen hellen Lichts werden gebündelt und zu einer Geschichte, zu vielen Geschichten zusammengefügt. Wer auch nur ein leises Interesse für die Kunst des Erzählens hegt, sollte den Projektoren mit Neugier begegnen: nicht nur ein Epos, sondern auch ganz großes Kino.
Die Projektoren von Clemens Meyer, S.Fischer Verlag, 1056 Seiten, 36€, Hardcover.
